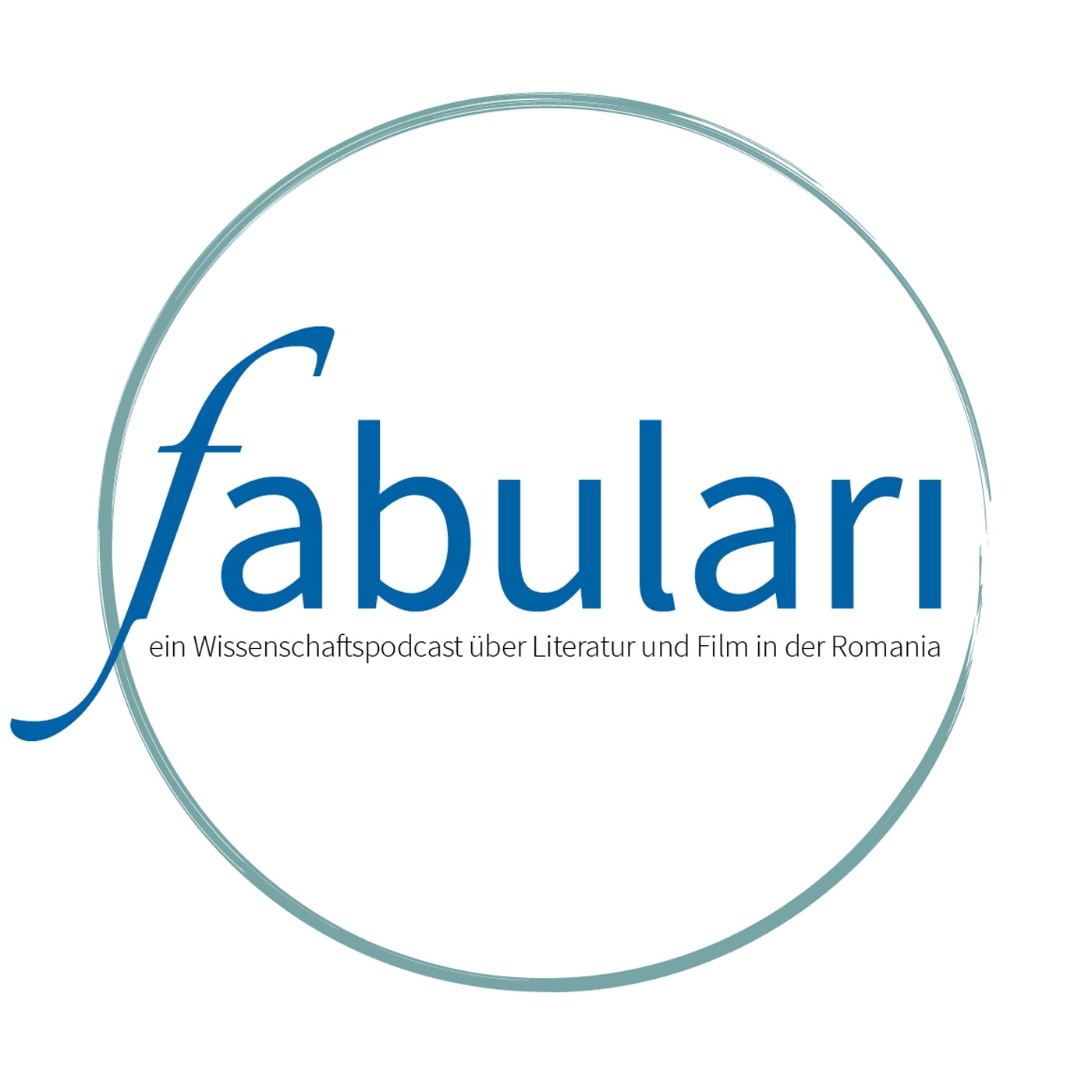
75: Moderne Diktatur? Lucia Filipova über Inszenierungen von Kinderstars in der franquistischen Gesellschaft
Spanien entwirft sich in den 1960er Jahren im Zuge von wirtschaftlichem Aufschwung und touristischer Öffnung als modernes Land neu. Gerade die mediale Selbstdarstellung in Fernsehen und Radio spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Dr. Lucia Filipova, Absolventin der Universität Wien, hat in ihrem PhD-Projekt an der Princeton University erforscht, welche Rolle Kinderstars wie Marisol für den Entwurf des neuen Spanienbilds spielen, behandelt deren öffentliche Auftritte als kulturelles Handeln an der Schnittstelle von propagandistischen, wirtschaftlichen und populärkulturellen Interessen, und illustriert die diskursive Verflechtung von Vorstellungen von Gesellschaft und Kindheit.
Interview: Teresa Hiergeist