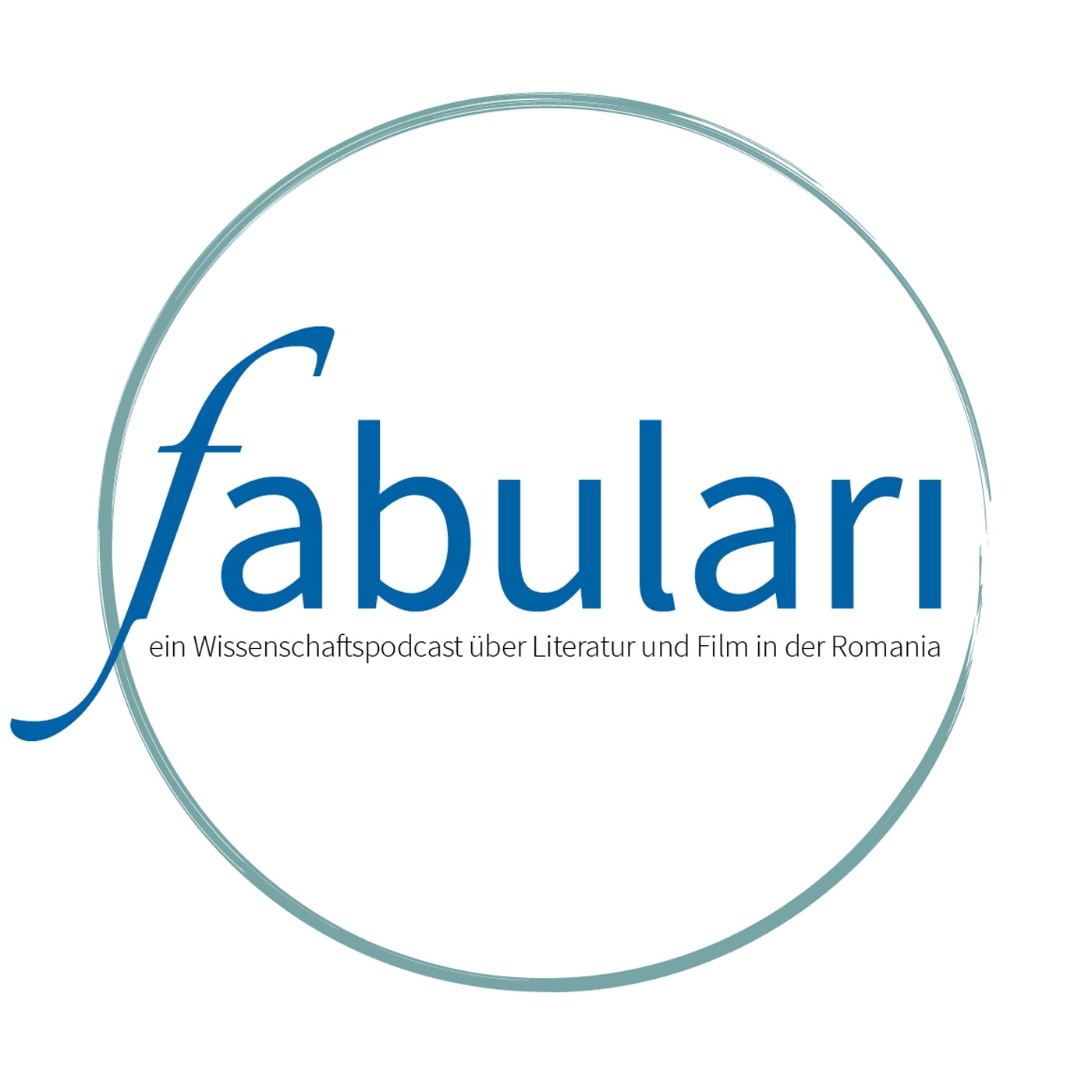
53: Penser les futurs trans. Pierre Niedergang sur les relations à l’œuvre chez Alexis Langlois
A l’heure ou l’offensive transphobe bat son plein en France, lea réalisateurice queer Alexis Langlois va présenter son nouveau film, Les Reines du drame, lors de la semaine de la critique à Cannes. Cette actualité est l’occasion de revenir sur son court-métrage De la terreur, mes sœurs! (2019), dans lequel quatre femmes trans évoquent les discriminations qu’elles subissent, et fantasment, dans une esthétique camp, sur leur vengeance. Pierre Niedergang, docteur et enseignant en philosophie à l’université Paris-Nanterre, nous explique en quoi ce court-métrage, aussi drôle que jubilatoire fait la part belle aux références queers, tout en proposant une réflexion sur...